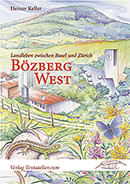BLOG vom: 11.05.2013
Der Anfang: Das Lasso, mit dem man Leser einfangen will
Autor: Walter Hess, Publizist, Biberstein AG/CH (Textatelier.com)
„Der Anfang ist die Hälfte des Ganzen.“
Aristoteles
Das Vorwort
Startschwierigkeiten? Anlasser kaputt? Das „Anfangen“ („Anfänge. Débuts. Inizi. Entschattas“) im Literaturbereich ist das Motto der Solothurner Literaturtage 2013. Autoren wie Michail Schischkin, Péter Esterházy und Ilma Rakusa widmen sich diesem Kunststück. Auch im Journalismus, dem kleinen Bruder des literarischen Schaffens, und beim Bloggen hat der Einstieg seine Bedeutung. Auf der Redaktion des „Aargauer Tagblatts“ durfte ich Ende April 1979 auftragsgemäss einen praxisbezogenen Vortrag über dieses Thema halten. Das Manuskript ist mir dieser Tage beim Straffen alter Dokumente wieder in die Hände gekommen. Aus aktuellem Anlass füge ich diese Antiquität hier an; einige aktuelle Bezüge sollen einen allfälligen Muff (Mief) vertreiben.
Ziemlich flach ist der Anfang des offiziellen Facebook-Texts zu den Literaturtagen ausgefallen: „Das Programm der 35. Solothurner Literaturtage bietet vom 10. bis 12. Mai Lesungen und Gespräche von und mit über 120 Autor/-innen und Übersetzer/-innen aus der ganzen Welt, zahlreiche Werkstattgespräche, Dialoge und Podiumsdiskussionen.“
Das sind gendergerecht aufgetischte Fakten, wie sie jeder untalentierte Volontär nach der Einführung in die neudeutsche Sprachregelung zusammenbasteln könnte. Das Thema hat also Verbesserungspotenzial, wie man sagt – bis hinein in die Medienabteilung der Filmtage.
Der Vortrag
Leeres Blatt. Blockade. Wie fange ich dieses Blog nur an?
Erledigt: Damit ist ja der Anfang schon gemacht – und damit die Hälfte des Ganzen. Die Zeichen und inhaltlichen Wunder können geschehen.
Hier geht es um das Anfangen, den Neubeginn, eine offenbar lustbetonte Tätigkeit. Zum Beispiel: Immer mehr Hochzivilisierte, selbst bestandene Ehepaare, verabschieden sich von ihrem jahrelangen Partner, um neu anfangen zu können. Bloss dem alten Trott entweichen! Der Erfolg der Neuorientierung ist nicht garantiert – dann bleibt zumindest ein Trottel zurück, ein Einfaltspinsel, der sich nicht einmal zum Malen eignet. Auch die grassierende Veränderungsmanie hat mit der Lust auf Neuanfänge zu tun. Die Vernichtung etablierter Werte bis hin zu den Grundsätzen der Ästhetik wird bei den Umwälzungen hingenommen. Kollateralschäden wie im Krieg.
Im Journalismus und in der Literatur misst man der Kunst des Anfangens eine unterschiedliche Bedeutung bei. In beiden Fällen ist der Anfang mit einem Lasso zu vergleichen: Man wirft eine Schlinge aus, in der sich die potenzielle Leserschaft verfangen soll. Die Kunst besteht dann nur noch darin, die Nutzer festzuhalten.
Entblödung um die Entblössung
Ein ausgezeichnetes Beispiel für einen gelungenen Einstieg in eine aktuelle Thematik servierte die „Weltwoche“ 2013-5, die offensichtlich talentierte Schreiber verpflichtet hat:
„Wenn man den Anfang eines Artikels liest, dann weiss man häufig sehr genau, was dann kommt. Das gilt besonders für Artikel, die in der Ich-Form geschrieben sind.
Was kommt in einem Artikel, der so beginnt: ,Für mich ist es nicht immer angenehm, 29 Jahre alt zu sein, eine Frau und Politikjournalistin’?
Es ist klar, was kommt. Es kommt in der Ich-Form etwas Persönliches, etwas Verletztes, es kommt jedenfalls etwas, das uns zeigt, dass die junge Journalistin (die Frau) sich selber für sehr wichtig im Journalismus hält.“
Die „Weltwoche“ (WW) zitierte den „Stern“, und WW-Redaktor Kurt W. Zimmermann verwurstete das geschickt und leitete auf den deutschen FDP-Politiker Rainer Brüderle über. Auf diesen wurde im Januar 2013 zur Medienjagd geblasen – das Jagdhorn ertönte erst ein ganzes Jahr nach dem angeblichen Vorfall. Die Zeit für eine Sexismus-Debatte schien endlich reif zu sein; die thematische Höhe ist nach heutigem Empfinden ranggleich mit Rassismus. Daraus lässt sich immer etwas zusammenbasteln.
Laura Himmelreich, die jetzt berühmte „Stern“-Journalistin, setze unverhofft zur publizistischen Hinrichtung an – ein vernunftbegabter deutscher Kommentator schrieb dazu etwas von „schäbig“. Mich nimmt bloss wunder, welchen psychischen Schaden die knallharte Journalistin wegen ein paar (unbestätigten) Annäherungsversuchen davongetragen haben könnte.
Der deutsche Philosoph und Schriftsteller Rüdiger Safranski, dessen kraftvolle Einsätze wir am Schweizer Fernsehen SRF jeweils im „Literaturclub“ ‒ eine von Stefan Zweifel hervorragend geleitete Sendung übrigens ‒ erleben dürfen, hatte das sich in den Vordergrund zwängende Thema Sexismus schon in der „DU“-Nummer 745 vom April 2004 geweissagt. Der Anfang seines Artikels über „Öffentlichkeit und Intimität“ teilt vorerst einmal ein paar fällige Peitschenhiebe aus:
„Für die (mediale) Öffentlichkeit ist das Private, näherhin das Intime, ein begehrter Rohstoff, vielfach verwendbar für Entlarvung, Voyeurismus, moralische Empörung, Unterhaltung, Skandal. Wer prominent werden will, drängt mit seiner Intimität in die Öffentlichkeit. Exhibitionismus verschafft öffentlichen Seelen Standortvorteile im Wettbewerb um Aufmerksamkeit.“
Am Ende werden Intimitäten zur Politik. Richard Gerd Bernardy schrieb mir kürzlich dazu: „Also: Das Intime ist ein beliebtes Mittel, das wirklich Relevante erst gar nicht zu bringen! Ich stelle übrigens fest, dass auch die von mir bisher als seriös beurteilten Zeitungen, Magazine und Fernsehsender auf dieser Welle reiten und in meinen Augen Klatsch- und Tratsch-Seiten einrichten, diese aber als seriös verkaufen.“
Der journalistische Zerfall geht weiter, was auf die Oberhand von Marketingleuten hindeutet.
Der Lead-Kult
Das journalistische Tagesgeschäft, das von solchen Entblössungen lebt, folgt seinen eigenen Regeln, die natürlich vom anglo-amerikanische Denken und System beeinflusst sind. Nicht allein in Bezug auf die Inhalte, sondern bis hin zur Form machen es sich die Berufsplagiatoren einfach: Das Wichtigste gehört an den Anfang. Punkt. Ein Dogma aus dem angelsächsischen Raum, wo der Bildungsferne des Publikums mit besonders simplen Methoden begegnet werden muss.
Das Wichtigste am Anfang: „Bei einem Flugzeugabsturz in B kamen am Mittwoch 4 Personen ums Leben.“ Diese Masche ist dem Agenturjournalismus exakt angepasst, den ich aus eigener, jahrelanger Mitarbeit bei der Schweizerischen Depeschenagentur (SDA) bestens kenne. Der Leser erfasst gleich aus den ersten Zeilen sekundenschnell, was in einer Nachricht steckt und braucht sich, wenn er nur oberflächlich interessiert ist, nicht durch das ganze Material durchzuwühlen; einen Nachrichtenkern wird er ohnehin nicht finden, weil es diesen nicht gibt.
Das Leadsystem (der Lead ist der Vorspann, das heisst: Die meist in Fettdruck wiedergegebenen ersten, zusammenfassenden Sätze) umfasst auch den Haupt- und einen allfälligen Obertitel. So ist also das, was der Journalist oder Redaktor als wesentlich erachtet, gleich in kompakter, vollumfänglicher Form vorangestellt. Es ist, als ob in einem Krimi der Täter schon in der Einleitung mit Name und Adresse präsentiert würde. Natürlich teilt dieser Vergleich das Schicksal aller Vergleiche: Er hinkt, weil eine Zeitungsmeldung kein Kriminalroman ist. Doch übereinstimmend wird hier und dort das Aufkommen von Spannung garantiert verhindert; man hat als Leser nichts Bewegendes mehr zu erwarten.
Das Schreiben eines Berichts nach abnehmender Bedeutung ist für den industrialisierten Journalismus, der für Druck- und Digitalmedien gleichermassen geeignet sein muss, die einfachste Lösung: Man kann von hinten her beliebig kürzen und so den Bericht zeilengenau für den Umbruch zurechtstutzen. Zu meiner Freude kennt man im Internet solche Längenbeschränkungen aus technischen Gründen nicht. Das ermöglicht es, einen komplexen Fall mit all seinen Zusammenhängen und auch bedeutungsvolle Einzelheiten zu beschreiben.
Schreib- und Sprachregelungen
Ich war noch nie ein Freund des Leadsystems; denn es ist eine Methode zur Leservertreibung, eine Einladung zum flüchtigen Lesen, zum Überfliegen. Gar fürchterlich fällt eine Berichterstattung aus, wenn sich der Journalist noch sklavisch an die 7 W (Wer? Was? Wo? Wann? Wie? Warum? Welche Quelle?) hält –auch im Nachrichtenwesen der Schweizer Armee waren solche W zu meiner Zeit noch eine wichtige Hilfstruppe. Derart starre Muster führen zum Schematismus, zur programmierten Langeweile.
Das ist ähnlich wie die fürchterlichen Sprachregelungen bei Radio und Fernsehen. Unsere nationalen Fernsehansager holen die immer gleichen Floskeln aus der Mottenkiste: „Hier sind die weiteren Meldungen des Thaaages“, als ob in einer aktuellen Nachrichtensendung Meldungen aus der tieferen Vergangenheit aufgetischt würden. Und mag die Zeit für das Meldungshackfleisch noch so knapp bemessen sein, immer bedanken sich die Moderatoren, wenn zum Beispiel um halb 8 Uhr abends (Tagesschau) ein Kollege 3 Sätze über den Inhalt der anstehenden Sendung „10vor10“ palavert hat: „Danke Stephan.“ ‒ „Danke Daniela.“‒ „Danke Christiane“. Die Ansager haben doch keinen Anlass für interne, gegenseitige Danksagungen vor versammeltem Publikum. Sie sind ausgezeichnet honoriert (auch von uns Gebührenzahlern) und ihr Geschwätz ist schliesslich ein integraler Bestandteil ihres Jobs. Niemand würde sich zwar beklagen, wenn es etwas gezügelt werden könnte.
Irgendwie ist die Branche zu einer Heerschar von Ausfüllern des immer gleichen Formulars geworden, die ebenso gut auf der Sparkassenabteilung einer Bank oder bei einem Statistischen Amt arbeiten könnten, und damit zu einer ernstzunehmenden Konkurrenz für die Schlafmittel-Produzenten. So verliert das Formulieren jeden Reiz, was uns Medienkonsumenten allerdings nicht besonders beelenden müsste, wenn unsere Lust am Lesen oder Zuhören nicht genau dasselbe Schicksal erleiden würde.
Ein Gestalten, ein Komponieren
Das Schreiben ist ein Gestalten, und dieses ist eine schöpferische Tätigkeit, die jedermann mit Erbauung erfüllen sollte – im Gegensatz zum Ausfüllen von Formularen wie die Steuererklärung. Man schaue bloss einmal den Kindern beim Spielen im Sand zu: Sie bannen flüchtiges Material, bauen Burgen. Sie komponieren. Und Composition ist der französische Ausdruck für Aufsatz, Abhandlung, Artikel – für etwas Zusammengesetztes. Das Gestalten macht Freude, und wer mit Freude schreibt, schreibt besser.
Der englische Zeitungsmann Cecil King (1901‒1987) vom „Daily Mirror“ hat einmal gesagt: „Ein Journalist hat nicht die Pflicht, geliebt zu werden. Aber er hat die Pflicht, gelesen zu werden.“ Die Pflicht, gelesen zu werden – alles andere wäre Papier- oder Sendezeitverschwendung ‒ bringt uns weiter.
Agenturmeldungen: Rohmaterial als Fertigprodukt
Die Grundlagen dazu liefern die Medienagenturen in die Medienunternehmen. Agenturberichte sind die Impulse für den Entscheid der Redaktionen, die geschickt auswählen müssten, sich wegen täglich mehrmaliger Sitzungen und dem Bombardement aus dem Internet & Co. ohnehin nicht mehr konzentrieren können. Agenturmeldungen sind Rohstoff für den redaktionellen Gebrauch, zusammen mit eigenen Quellen eine Entscheidungshilfe, was dem Publikum wie aufbereitet vorgesetzt werden soll.
Das war einmal. Heute werden die Agenturmeldungen telquel übernommen, ein wichtiges Element der mainstreamig verödeten Medienlandschaft. Man erkennt den Uniformismus wunderschön, wenn man unter Google auf „News“ geht – manchmal gibt es Hunderte von gleichen Titeln und gleichen, wörtlich übereinstimmenden Meldungen.
Zeitschriften mit weniger Zeitdruck
Zeitschriften, die nicht vom Tagesgeschäft gehetzt sind, können einem bestimmten Thema mehr Platz einräumen, haben andere, vorteilhaftere Voraussetzungen. Sie können beschreiben, weil sie mehr Zeit zur Verfügung haben. Die Einleitung muss bei den Magazinen kein Feuerwerklein aus den wichtigen Aussagen sein, sondern sie kann durch die Schilderung einer Person, eines Schauplatzes, einer untergeordneten Begebenheit für Atmosphäre sorgen, ähnlich der Lobby (Eingangshalle) eines Hotels. Und wenn der Leser in diese Aura eingebettet ist, wird er nicht so schnell wieder davonlaufen. Ein schönes Beispiel dazu aus „Der Spiegel“ der 1970er-Jahre:
„Im Kinosaal hinter Barbara Valentin sitzt ein junger Mann. Die Dunkelheit ermutigt ihn, sie, in ihren Nacken hineinsprechend, um eine Locke zu bitten. Sie sagt: Wenn Sie eine Schere haben. Auf der Leinwand läuft ...“.
Dann lenkt die offensichtlich talentierte „Spiegel“-Reporterin das Interesse des Lesers von Barbara Valentin hin zur Leinwand, und in ähnlich anregender Art wird der Film geschildert. Der Leser ist dabei, und muss bei der Stange gehalten werden, denn ein Druckerzeugnis, das ihn zum Lesen animiert, wird er als interessant empfinden und es wieder abonnieren.
Dieses Vorgehen ist das Gegenteil des Leadsystems, jenem Ausdruck einer verkehrten Zeitungswelt, welcher die Leser als lästig, als Belästigung, empfindet. Hier wird die Geschichte immer dünner – im Gegensatz zur „Spiegel“-Beschreibung. In der Gastronomie kommt es doch niemandem in den Sinn, zuerst die üppigsten Weine zu einem Braten in einer kräftigen Weinsauce zu servieren und dann, bei abnehmendem Geschmack, mit einem Lachs-Kanapee zu einem zarten Weisswein zu enden.
Es lebe der Sport!
Guter, kunstvoll schildernder Journalismus braucht nicht den Zeitschriften vorbehalten zu sein – sogar der im Allgemeinen floskelhafte Sportteil könnte neues Leben erhalten, obschon die Bedeutung des Sports blasenartig aufgebauscht ist. So beschrieb die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ (FAZ) am 11.12.1978 einen Tennismatch einleitend so, ein informatives Glanzstück:
„Die Zuschauer scheinen den Atem angehalten zu haben, denn zum ersten Male war es beim Tennis-Cup in der grossen Frankfurter Festhalle mäuschenstill. Nur die Köpfe bewegten sich hin und her. Fasziniert folgten die rund 5000 Besucher dem Flug des Balls. Sie trauten ihren Augen nicht. Was sich auf dem grünen Kunststoffteppich unter dem gleissenden Licht der Halogen-Scheinwerfer abspielte, war die Demontage eines Denkmals.“
Es ging um den Match des Rumänen Ilie Nastases gegen das Denkmal James Scott Connors (USA). Über den gleichen Match hatten die meisten anderen Zeitungen agenturstilmässig so berichtet:
„Auf seinem Weg in den Final eliminierte Nastase den Amerikaner Connors mit 6:1, 6:2. Connors hatte zuvor problemlos mit 6:3, 6:1 Tom Okker geschlagen.“
Das sind schon 2 Welten: kunstvoll die eine, formularhaft die andere.
Kurz und prägnant
Selbst Kurzbotschaften können attraktiv sein. Als das Telefon 11 (Auskunft) aufgehoben wurde, hat mir ein junger Redaktor 2 Vorschläge zur Beurteilung vorgelegt:
„Heute Freitag, kurz vor 21 Uhr, wird zum letzten Mal ein charmantes Fräulein in Aarau Auskunft geben.“
Die originellere, reizvollere Variante:
„Man sieht sie nicht, und immer geben sie freundlich Auskunft: Das sind die Telefonistinnen von Nummer 11 – die da stöpseln und nun eben zügeln müssen.“
Otto von Bismarck (1815‒1898) brauchte für den Anfang seiner politischen Lebensgeschichte keine hochgeschwellten Einleitungsphrasen. Er leitete sachlich ein:
„Als normales Produkt unseres staatlichen Unterrichts verliess ich Ostern 1832 die Schule als Pantheist, und wenn nicht als Republikaner, doch mit der Überzeugung, dass die Republik die vernünftigste Staatsform sei.“
Dies ist ein überzeugender Anfang, von schon fast pantheistischen (Pantheismus: Gott-und-Welt-Einheit) Dimensionen. Man hat es sogleich mit einem heranreifenden Jüngling zu tun, mit seinen Ansichten über die Grundfragen des Glaubens und des Staatslebens. Und der Leser erwartet mit Spannung, wie sich der junge Mann weiterentwickelt.
Personifiziert
Auch beim Zeitungsschreiben sind auf die Person bezogene Einleitungen immer empfehlenswert. Hier nochmals ein FAZ-Zitat aus den 1970er-Jahren:
„Falls der Kanzler enttäuscht war, so liess er es sich nicht anmerken. Nach fast 24 Stunden währenden Verhandlungen, die nur kurzer Schlaf unterbrochen hatte, schilderte ein immer noch konzentriert und gesammelt wirkender Helmut Schmidt, wie die Tagung der Regierungschefs der Europäischen Gemeinschaft verlaufen ist. Etwas blass, aber ohne jede Emotion, geriet die Darstellung zu einem kühlen Rechenschaftsbericht.“
Personifizierte Berichte – schliesslich sind es ja oft genug Menschen, die für Betrieb sorgen – sind immer ansprechend, kommen gut an. Im „Aargauer Tagblatt“ vom 02.02.1979 begann Heiner Halder seine Darstellung des Musikfantums so:
„Greift er zum Kehrichtsack, liegen ihm die Fans zu Füssen. Fingert er am Festerladen, jubeln die Massen. Das rhythmische Rascheln und Rütteln, Schlagen und Schütteln des Roland Baldenweg bedeutet Musik in den Ohren seines Publikums. Er machte Karriere mit dem Kehrichtsack.“
Gratistip für Spätberufene: Auch mit Hilfe von Toilettenpapierrollen und den überteuerten Staubsaugerbeuteln liesse sich eine übersteigerte Publikumsbegeisterung generieren.
Ein Meister der Klarheit im Schreiben und damit auch im Anfangen ist der Sherlock-Holmes-Autor Conan Doyle. In den ersten Zeilen seines Kriminalromans „Sherlock Holmes und die gefährliche Erbschaft“ liefert er Fakten, die er gleich in Spannung umsetzt – ein Vorbild für Polizeiberichterstatter:
„Im Frühling des Jahrs 1984 hielt ganz London den Atem an; aus Sensationslust die meisten, aus Empörung die oberen Zahntausend: Einer ihrer Standesgenossen, Ronald Adair, war ermordet worden, und dies unter höchst ungewöhnlichen, ja unerklärlichen Umständen. Angesichts der Ungeheuerlichkeit des Falls hielt man es bei den zuständigen Stellen für richtiger, gewisse Einzelheiten zurückzubehalten“.
Da muss man einfach weiterlesen. Spannung ist ein wichtiges Mittel, den Leser bei der Stange zu halten ... und schliesslich sollte alles getan werden, um ihn zur Kunst und den Freuden des Lesens zurückzuführen.
Die grossen Kriminalfälle werden selbstverständlich von den Medien noch immer mit Inbrunst gepflegt ... und inzwischen haben sich auch noch die Schmuddeligkeiten ihren festen medialen Platz gesichert (siehe Laura Himmelreich). Ein AT-Redaktor, Ernst Rothenbach, setzte geradezu zu schriftstellerischen Höhenflügen an, wenn er über eindeutig Zweideutiges berichtete, zum Beispiel über einen Freier, der nicht tun durfte, wofür er im Voraus bezahlt hatte (der Fall trug sich im Februar 1978 zu):
„Ein Aargauer Landwirt, Nichttrinker, bändelte mit einer Tänzerin an, akzeptierte die Offerte für ein Schäferstündchen von 300 harten Schweizerfranken, bezahlte auch – und wartete nachher vergeblich auf die Schöne, die entrückt war, ohne das zu leisten, was abgemacht worden war. Vor dem Brugger Bezirksgericht hiess das Beischlafbetrug, was die angeklagte Erzengelin nicht hörte, weil sie gar nicht erschienen war.“
Nach solch Apérohäppchen liest man gern weiter, weil man ja erfahren möchte, wie die Richter bei all der gebotenen Härte entschieden haben.
Das Protokoll - zwischen Wiege und Bahre
Das pure Gegenteil von mitreissenden Berichten ist der chronologische Protokolljournalismus:
„Unter der speditiven Leitung von Präsident M. St. hielt die im Jahre 1977 nach fast 20-jährigem Dornröschenschlaf reaktivierte Naturschutzgruppe ihre Jahresversammlung ab.“
Die Redaktion hätte den braven Naturschützern etwas zur Hand gehen müssen, um die Chance zu erhöhen, dass auch die folgenden Zeilen gelesen werden. Ein kleines, vorangestelltes Detail könnte den Aufmerksamkeitsgrad erhöhen.
Auch bei grossen Schriftstellern wie Gottfried Keller kann es Anfänge geben, die vor Langeweile triefen (wie in „Die Leute von Seldwyla“):
„Seldwyla bedeutet nach der älteren Sprache einen wonnigen und sonnigen Ort, und so ist auch in der Tat die kleine Stadt dieses Namens, gelegen irgendwo in der Schweiz.“
Keller wollte die Leser an den fiktiven Ort des Geschehens entführen und liess durchblicken, dass dieses Seldwyla überall in der Schweiz sein kann. Lesenswert ist dieser Roman alleweil.
Ein Wort voraus
Eine Einleitung kann durchaus ihre Bedeutung haben, gerade wenn sie in einen schwer überschaubaren Tatbestand hineinleitet – vor allem auch bei komplex angelegten Sachbüchern. Sie kann das Wissen vorausschicken, das zum Verständnis einer Arbeit überhaupt nötig ist; das Vorbereiten einer Stimmung ist weniger ihre Sache. Aber man kann die Einleitung durchaus mit einem anregenden Gedanken ausschmücken, um ihr die Langeweile zu nehmen. Der Kolumnist und Börsenguru André Kostolany (1906‒1999) lieferte in der „Weltwoche“ vom 15.11.1978 zuerst einen Gedanken und lud auf diese Weise zum Lesen ein:
„,Ich lehre nicht, ich erzähle’, sagte der französische Philosoph Michel de Montaigne. Ich werde nun eine dramatische Episode der Finanzgeschichte erzählen, aus der die Devisenhändler, Spieler und Makler mehr lernen werden als aus mehreren Jahren Studium der Betriebswirtschaft. Sie wurde mir vor 50 Jahren vom 80-jährigen Wall-Street-Börsianer erzählt, der sie selber als Augenzeuge erlebt hat. Man schrieb September 1869. Der Dollar war Gegenstand eines heftigen Spekulationsangriffs.“
Und so weiter. Wahrscheinlich ist jene „Weltwoche“-Ausgabe vergriffen.
Humor
Im Zeichen der Gleichberechtigung hat der Humor dasselbe Recht wie der Ernst, womit man allerdings auch anecken kann. Nur einen Witz einzufügen, fällt nicht unter Humor. Eine Humorverköstigung, die ankommt, braucht mehr: Der Humor muss eingebettet, vernetzt sein. Wenn man über einen humorvollen Gedanken noch lachen kann, sind das Höhepunkte. Mir ist das kürzlich sogar bei einem Kabarettprogramm passiert, ehrlich.
Heinrich Seidel, der deutsche Ingenieur und Schriftsteller (1842‒1906) begann seine nicht durchwegs ernsthaft geratene Lebensgeschichte so, gewürzt mit einer Prise Galgenhumor:
„Es geht eine dunkle Sage, dass der Urahn meiner Familie wegen irgendeines Verbrechens aus der Schweiz entflohen sei. Man nagelte dort, da man seiner selbst nicht mehr habhaft werden konnte, sein Bildnis an den Galgen. Er aber wandte sich nach Sachsen und gründete dort ein zahlreiches Geschlecht.“
Eine stolze Abstammung aus einer Familie, die nicht unterzukriegen ist.
Der Anreisser
Ein bescheidener Anreisser wirkt manchmal verlockend. In einer alten „Beobachter“-Nummer schrieb Markus M. Ronner:
„Ein modernes Märchen: Es war einmal ein Mann namens Rudolf Schreiber, der auszog, seinen Landsleuten Verständnis für die Notwendigkeit des Vogelschutzes beizubringen.“
Etwas anders gesagt, und deshalb angenehm originell,
Abgedroschenes ist zu vermeiden: „Am nächsten Donnerstag ist es soweit ...“. Das ist ein Abschrecker, kein Anreisser.
Oder: „Vorgeschichte und Hintergründe sind bekannt ...“. Dann braucht man doch nicht in die Tastatur zu greifen.
*
Wie der Anfang, so das Ende (Sprichwort). Meine Betrachtung über das Anfangen ist nur so lang geworden, weil ich vor lauter Anfängen viel zu weit weg vom Ende war und dieses nicht finden konnte.
Quelle
Diesem Blog liegt der Vortrag zugrunde, den Walter Hess am 25.04.1979 im Rahmen der redaktionellen Weiterbildung an der Redaktionssitzung des „Aargauer Tagblatts“ in Aarau gehalten hat.
Hinweis auf ein weiteres Blog zum Thema Anfang
08.05.2012: „Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne...“
Hinweis auf weitere Blogs von Eisenkopf Werner
Der neue Kirchen-Teufel 2024 ist BLAU
Deutsche Bauernproteste als Mosaikstein gegen grüne Weltbeglücker
Kommunale Walliser Foto-Stative und Rätsel zur Mischabelgruppe
"65" ist in Deutschland offenbar das neue "42"? HABECK-Heizungs-Science-Fiction?
"KLIMA-PASS" vorgeschlagen - Betrug mit Meeresspiegel als Einwanderungshilfe?
84 Millionen im Klammergriff eines Polit-Clans?
Wird deutsche Politik jetzt zum "GeTWITTERten Comic" ?
Die EU für Schweizer - einmal anders betrachtet (Teil 2)
Die EU für Schweizer - einmal anders betrachtet (Teil 1)
SOCIAL-MEDIA und die Freude an der Nicht-Existenz
KLIMA - Extreme Hitze und Trockenheit gab es bereits oft und schlimmer
Extremhochwasser und Hunderte Tote an der deutschen Ahr - seit 1348 aufgezeichnet
Will die CH der BRD in die totale Zwangswirtschaft folgen?
Ketzerworte zur CO2-Gesetzgebung und CH-Abstimmung am 13. Juni 2021