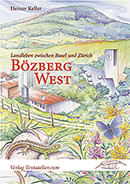BLOG vom: 24.08.2013
Der Zeitungsschreiber und sein Stil: miniaturisiert, banalisiert
Autor: Walter Hess, Publizist, Biberstein AG/CH (Textatelier.com)
Die Sprache und die Ausdrucksfähigkeit sind generell am Zerfallen. Die Lesekompetenz auch. Die Druckmedien haben sich darauf eingestellt. Zudem sind sie vom Stakkato der Rumpfbotschaften beeinflusst, die in der digitalen Welt herumschwirren und haben damit selber zur Zerstörung des Lesens beigetragen – ein unverständlicher Vorgang. Dabei wäre das Internet als Rechnernetzwerk zur Datenübertragung problemlos in der Lage, auch Langfutter zu bewältigen.
„Fasse dich kurz“, lautet die neue Mode des Schreibens – ohne Rücksicht auf Verluste. Der Rudeljournalismus denkt über diesen Modetrend nicht nach, zumal das Nachdenken nicht zum Mitläufertum gehört. Viele Einzelheiten fallen wegen der Verkürzung auf Nimmerwiedersehen unter den Schreibtisch. Mit den Texten und einzelnen Sätzen wird auch das Denken eingeengt – für grössere Zusammenhänge, Hintergründe, bildwirksame Details gibt es keinen Platz mehr – Fotografien, heute spielend herzustellen und billig, ersetzten das geschriebene Wort zunehmend. Die miserable Informiertheit der modernen Menschen innerhalb einer Überfülle an zerhackten Informationen ist eine Folge davon. Vielfältig vernetzte innere Beziehungen von Ereignissen werden ausgeklammert. Alles wird auf eine Anhäufung von Fakten reduziert, die wegen der Losgelöstheit wertlos sind. Über die Länge und Kürze wird weiter hinten noch eingehend philosophiert.
Bemühungen, den Stil zu verbessern
Die Art des Schreibens hat mich immer lebhaft interessiert. Während und nach meiner Tätigkeit in der chemischen Forschung absolvierte ich alle Fernkurse, die das damalige Zeitungsinstitut Werner Welz, Hameln D, anbot. Über meine Textproben wurde korrespondiert, und ich fühlte mich als Gegenüber von Menschen, welche die Sprache beherrschten und mich auf Schwächen und Fehler aufmerksam machten, bestens aufgehoben.
Dabei suchte ich nach einer eigenen, persönlichen Ausdrucksweise; ich brachte es beispielsweise nicht fertig, hirnlos das angelsächsische Leadsystem (in einem Vorspann ist alles Wesentliche zusammengefasst) zu übernehmen, weil es jede Art von Spannung von Anfang an totschlägt. Schreibt man nach dem Ranking der abnehmenden Wichtigkeit, produziert man wenigstens nebenwirkungsfreie journalistische Schlafmittel. Doch weiss ich schon, dass die Sensationspresse mit dem Herausposaunen des aufgemotzen (Un-)Wesentlichen ihre Geschäfte macht. Auf der anderen Seite hatte auch „Der Spiegel“ einen guten Erfolg, der seine umfangreichen, farbig geschriebenen Reportagen vom Detail zum Allgemeinen laufen liess – und nicht etwa umgekehrt.
Die Art des Schreibens wird im Journalismus (ob auf Papier oder digital) kaum noch der kritischen Betrachtung ausgesetzt, was viel mit Prüderie zu tun hat – die Medienkritik gibt es höchstens noch in Restbeständen. Diese Unterlassungssünde spürt man als Leser. Immerhin habe ich ein unvergessliches, positives Beispiel aus der angenehmen Zeit, als ich noch Mitglied der Redaktion des ehemaligen „Aargauer Tagblatts“ (AT, heute: Aargauer Zeitung) war. In den 1970-er Jahren durfte ich an den wöchentlichen Redaktionssitzungen auf Wunsch der Chefredaktoren Dr. Kurt Lareida und dann Dr. Samuel Siegrist jeden Monat einmal einen Vortrag über ganz verschiedene Aspekte des Zeitungsschreibens halten, zumal mir persönlich ohnehin viel daran lag, dieses Handwerk ständig zu perfektionieren. Meine Zuhörer bestanden aus Akademikern aus verschiedenen Fachrichtungen, vor allem solche mit Bezug zur Politik, Wirtschaft (Volkswirtschaft), ehemaligen Lehrern usf. Es waren geübte Schreiber, die druckreif diktierten, sich aber gern anregen liessen, um den eigenen Stil zu perfektionieren. Schaut man die heutigen Ausbildungsprogramme für Medienschaffende durch, wird offenbar, dass es vor allem um die Nutzbarmachung von PR- und anderen Werbebeiträgen geht. Man denkt an den Ertrag und vergisst Qualitätsaspekte. Früher ging es um Abgrenzungen; Informationen und Kommentare wurden von der Werbung getrennt.
Wiederbelebter Vortrag von 1978
Im Vortrag vom 14.06.1978 wandte ich mich dem Thema „Der Zeitungsschreiber und sein Stil“ zu. Ich wollte dabei nicht als Besserwisser auftreten, sondern einfach einige Gedanken dazu vermitteln, wie man Informationen und Meinungen attraktiver aufbereiten könnte. Man soll ja den Abonnenten das intensive Lesen schmackhaft machen und nicht etwa vergällen. Nur dann, wenn er zum Lesen animiert wird, bewertet ein Leser eine Zeitung als gut, interessant. Der Ruf der Zeitung gewinnt, die Auflage steigt – und umgekehrt. Und schliesslich will der Zeitungsschreiber als Mitglied der 5. Gewalt angesehen sein, ernst genommen werden, manchmal auf Missstände aufmerksam machen und etwas erreichen. Das ist legitim, wenn immer das auf seriösen, fundierten Grundlagen beruht.
Bildhaft und volksnah
Für meine zeitungskritischen Vorträge standen mir aus dem AT genügend Beispiele zur Verfügung, auch vorbildliche. Steigen wir gleich mit einem guten Beispiel in die Mitte der Dinge ein.
Bildhaft und kraftvoll formulierte Chefredaktor Siegrist: „Viel vom angestauten Dampf gegen die SRG (Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft) könnte schon mit der Einführung eines unbürokratischen Gegendarstellungsrechts abgelassen werden (...) Im durchbürokratisierten, programmfernen Apparat des Grossunternehmens SRG herrscht eine derartige Unbeweglichkeit, dass sich guter Wille nicht nach unten durchschlägt.“
Solches packt, rüttelt auf, weist auf Missstände hin. Die Sprache veranschaulicht den Sachverhalt deutlich. Das eigene Weiterdenken findet hier einen guten Nährboden.
Bei Gerichtsberichterstattungen, die aus dem Alltagsleben des Volks herauswuchsen, ist eine volkstümliche Sprache angezeigt, die Redaktor Peter Schmid, ehemaliger Lehrer, beherrschte: „Aus einem kleinen Möstli werden schnell wieder grosse, meinten die Richter, und sie forderten Sepp auf, eine richtige Entziehungskur zu machen. Sepp versprach es.“
Meines Erachtens sind alle Stilarten im gegebenen Zusammenhang erlaubt – mit Ausnahme der langweiligen. Unser Fotoreporter Heinz Fröhlich war ein leidenschaftlicher Anhänger des Partizips: „Die drohende Gefahr erkennend ...“ – „brennend seien die Arbeitskollegen vom Dach gerannt“. Das Partizip ist ein aus alten Sprachen übernommen, das auch von Johann Wolfgang von Goethe häufig verwendet wurde. Es darf gewiss sein, aber man sollte seine Anwendung nicht übertreiben.
Langweilig sind demgegenüber eine hohle Geschwätzigkeit und Verschwommenheit: „Der 11. Parteitag wurde in Jugoslawien mit grosser Sorgfalt vorbereitet.“
Dass Massenveranstaltungen ebenso wie kleinere Anlässe sorgfältig vorbereitet werden, will man hoffen. Der Satz verkündet eine Scheininformation, für die kein Markt besteht. Stattdessen müsste man es im Journalismus so halten wie bei Arthur Schopenhauer jener gute Koch, der es verstanden hat, eine harte Schuhsohle geniessbar herzurichten. Journalistische Texte müssen lebendig, lebenserfüllt sein. Das gelingt gerade im politischen Bereich nicht immer, und manchmal trägt eine Verwedelungsabsicht dazu bei. 1978 war in einer Berichterstattung aus dem Bundeshaus in Bern von „gewissen hängigen Problemen“ und „gewissen grundsätzlichen Fragen“ zu lesen. Und der Autor fand stilrein den Schluss: „Gewisse Anzeichen deuten darauf hin, dass sich die Fiskaleinnahmen des Bundes in nächster Zeit nicht wesentlich verbessern werden.“
Das war ein kaum noch zu unterbietender journalistischer Tiefpunkt.
Wie herrlich einfach ist demgegenüber die alte Redensart „Morgenstund’ hat Gold im Mund“. Ein schlechter Journalist würde dasselbe so umschreibend ausformulieren: „Nach dem Nachtablauf pflegt die Stunde ein Edelmetall zwischen den Zähnen aufzuweisen.“
Ähnlich kompliziert, mit Partizip-Einschluss, schrieb ein Musikberichterstatter: „Der Wagemut des Veranstalters wurde zum Abschluss des Bachfests durch eine die Kirche bis zum letzten Platz besetzt haltende Hörerschaft belohnt.“
Statt einfacher: „Der Wagemut der Bachfest-Veranstalter lohnte sich. Die Kirche war wieder voll.“
Die geschwollenen Überschriftsteller
Ein gesuchter, verkrampfter, geschwollener Stil ist so unansehnlich wie ein geschwollenes Auge. Es besteht kein Anlass, an Wörtern und Ausdrücken achtlos vorbeizugehen, die sich als die natürlichen aufdrängen. Mit diesem Einfachen, Normalen, Natürlichen haben sich auch grosse Schriftsteller begnügt. Nur für die Überschriftsteller aus dem Tagesgeschäft ist das normale Wort oft zu simpel. Ein wunderbar einfaches Tätigkeitswort ist zum Beispiel sagen: Das darf man sicher sagen. Gesagt, getan. Wenn etwas normal ausgesprochen, geäussert wurde, soll man das Verb „sagen“ bedenkenlos gebrauchen. Aber wenn das Sprechen von der üblichen Art des Ausdrucks abweicht, soll man das treffende Wort anwenden: reden, flüstern, schreien, fluchen, murmeln, maulen, kundtun usw.
So erreicht man am ehesten eine sagenhafte Sprache. Auch Wiederholungen von einem bereits verwendeten Wort sind sinnvoll. Es erleichtert das Verständnis, wenn die gleiche Sache mit dem gleichen Wort bezeichnet wird.
Viele Schreiber sind im Schulunterricht sozusagen deformiert worden, weil ihnen Wortwiederholungen und einfache Verben wie „sagen“ und „gehen“ untersagt worden sind. Solche Lehrer hätten Nachhilfeunterricht verdient.
Themengerechtigkeit
Kein einziger Stil kann sich für jedes Thema eignen. Denn die Art und Weise, sich auszudrücken, ist ein Zusammenklang von Gegenstand und Ton. Zwar schreibt, wer ein trockenes und nüchternes Wesen ist, auch trocken und nüchtern. Er kann nicht anders. Das kann wirken. Ein Fantasiemensch aber schreibt farbig. Auch das kann wirken.
Was niemals eine Wirkung erzeigt, ist die Lauheit. Sie drängt dem Leser die Frage auf: Warum wird ein Problem, das offensichtlich nicht einmal den Verfasser eines Artikels interessiert, denn überhaupt behandelt?
Davon hob sich eine prägnante Formulierung von Redaktor Hanspeter Widmer positiv ab. Sie betraf eine Regierungsratsvernehmlassung zum Flugplatz Birrfeld AG: „Diese Stellungnahme ist ein Skandal.“ Das ist kein sanftes Säuseln zwischen den Zeilen. Das haut. Selbstredend muss das vernichtende Urteil intelligent begründet werden.
Wenn einer über eine Humoresken-Aufführung im Theater trocken schreibt, ein fröhliches Musikantenfest oder einen Alpaufzug von Kühen mit tierischem Ernst behandelt, wenn er über eine Ausstellung von Bildern aus dem Barock farblos, unterkühlt schreibt, klaffen Gegenstand und Stil auseinander. Dies ist eine Stillosigkeit, eine Stilwidrigkeit.
Ein bisschen Populismus tut gut
Wie auch immer: Für den Zeitungs- bzw. Massengebrauch sollte der Stil einigermassen volkstümlich sein. Gewöhnliche, treffende Worte sind auch dann richtig, wenn ungewöhnliche Dinge gesagt oder beschrieben werden. Für denjenigen, der durchgehend verstanden werden will, ist die Volkstümlichkeit gewissermassen Pflicht – heute nennt man das mit Bezug auf politische Äusserungen eher despektierlich Populismus, weil so die Gunst der Massen gewonnen werden soll und auch wird. Wer sich unverständlich, gewunden ausdrückt, findet keinen Zuspruch.
In der Schweiz liegt zwischen der Sprech- und der Schreibsprache eine tiefe Kluft, so dass hier ein volksnaher Stil unerlässlich ist. Doch das hat einen Vorteil: Wir müssen die Ausdrucksweise in der Schriftsprache mühsam erlernen und uns dabei auch mit stilistischen Aspekten befassen. Dabei darf auch die Mundart gelegentlich belebend einfliessen.
In diesem Sinne einen schönen Satz schrieb einmal AT-(Chef)Redaktor Franz Straub: „Die Sozialdemokratische Partei liegt mit ihren Empfehlungen 20 Mal lätz“ (wobei „lätz“ = falsch bedeutet).
Fremd- und Fachwörter
Nicht zur volksnahen Ausdrucksweise passt die ganze Fremdwörterei – mit den inzwischen zur wahren Seuche gewordenen Anglizismen, welche alle Sprachen durchdringen, Meilensteine auf dem Weg zur faschistischen Internationale. Einige englische Ausdrücke haben sich eingebürgert (Computer, Baby und auch das scheussliche Event = Ereignis, Veranstaltung usw.), andere sind aus Wichtigtuerei übernommen (Contest statt Wettkampf), sind unnötig und verderben bloss den Stil.
Ins gleiche Kapitel gehören auch Fachausdrücke, die nicht unbedingt sein müssten. Wer beispielsweise von „hydraulischer Energie“ palavert, hat das fliessende Wasser nicht vor sich gesehen, ansonsten er „Wasserkraft“ geschrieben hätte. Die Fremdwörterei, die einst in den Ressorts Ausland und Wirtschaft am schlimmsten war, hat sich inzwischen flächendeckend ausgebreitet.
Die folgenden Fremd- und Fachwörter stammen alle aus dem Vorspann eines Ausland-Leitartikels: Dogmatismus, pseudorevolutionäre Aktivitäten, monopolistische Strömungen und Hypothesen.
„Sag’ mal, Karl, kannst Du noch Deutsch?“ Dies soll in der fernen Vergangenheit die aufgeschreckte Frage des damaligen deutschen Verteidigungsministers Helmut Schmidt an Wirtschaftsminister Karl Schiller gewesen sein, nachdem Schmidts ehemaliger Professor im Bonner Kabinett eine Rede im typischen Ökonomen- und Soziologenchinesisch gehalten hatte. Vom „sozioökonomischen Kontext“ über die „systemimmanente Kontraproduktivität“ bis zur „kognitiven Rezeption makroökonomischer Differenzierungen“ soll dabei nichts gefehlt haben. Das tönte zwar gelehrt, sagte aber wenig aus – auf solche Töne verzichten Zuhörer und Leser noch so gern.
Wenn sich ein Phänomen so breitenwirksam entwickelt wie der Sport, wird der spezielle Fachjargon zum Allgemeingut. So schrieb AT-Redaktor Kurt Hennefarth in einem Bericht über das St. Galler Pferderennen: „Der durch seinen Stil beeindruckende Deutsche, Jürgen Ernst, kassierte nach einem vorsichtigen Ritt am letzten Sprung eine Stange.“
Wie jede Sportart, so hat auch jeder Berichterstatter seinen eigenen Stil, und beides wird dann irgendwie vermanscht. Dabei muss man aufpassen, dass man selber keine Stange kassiert. Sie könnte beispielsweise in Form des Vorwurfs auftauchen, man habe vor lauter Stilverrenkungen nicht objektiv genug informiert.
Die Objektivität, die es nicht gibt
Doch mit dieser Objektivität ist es ohnehin so eine Sache. Objektiv sind höchstens Logarithmentafeln und Ranglisten. Anderseits darf sich auch das subjektive Schreiben einiger Vorteile rühmen: Es lässt den Leser erahnen, dass hinter dem Geschriebenen ein menschliches Subjekt steht, weshalb es grundfalsch ist, die Ich-Form zu verpönen. Die Subjektivität prägt den eigenen Stil entscheidend mit.
Viele literarische Werke beeindrucken nicht nur wegen ihres Inhalts, sondern durch ihren Stil. Dieser Bezug hinkt innerhalb der Thematik dieses Blogs selbstverständlich; denn Zeitungen sind keine literarischen Werke – und Zeitungen überdauern die Zeit bestenfalls in Archiven, sind im Wesentlichen also Wegwerfkonstrukte. Aber meines Erachtens wäre es nicht verboten, ein wenig von talentierten Literaten zu lernen und von der unpersönlichen Schreiberei im Agentur- oder Amtsstil, die es beide zum gleich hohen Grad an Unpersönlichkeit gebracht haben, abzurücken. Es gibt nichts Öderes als über den gleichen Leisten geschlagene Satz-Ansammlungen.
Die Angst vor dem Eingeständnis der Subjektivität – jeder Text ist subjektiv, dieser ganz besonders – rührt zu einem guten Teil vom krampfhaft angestrebten, verkrampften Trennen von Information und Kommentar her. Wenn das zu unpersönlichen Schreibereien führt, ist das ein hoher Preis. Die Einhaltung des Prinzips Trennung müsste preisgünstiger zu erreichen sein: Man kann Berichte mit eigenen, detailliert beschriebenen Beobachtungen anreichern. Selbst politische Berichte müssten nicht abstrakt und trocken sein. Politik wird durch Menschen gemacht, und Menschen sind interessant.
Dazu ein gutes Beispiel aus der Feder des seinerzeitigen Pariser Korrespondenten des AT: „Valéry Giscard d’Estaing erschien vor der internationalen Presse selbstsicherer und gelöster als je zuvor. Über 2 Stunden lang stand er lächelnd Rede und Antwort, gab sich in der Wirtschaftspolitik zielsicher und im Umgang mit der linken Opposition flexibel.“
Man soll Menschen beobachten und beschreiben (sie nicht einfach ablichten), Stimmungen erfühlen und ebenfalls beschreiben, kleine, bezeichnende Ereignis exakt registrieren. Dafür muss natürlich genügend Platz vorhanden sein, der heute wegen der dominanten Bildflächen und dem damit verbundenen Zwang zum Kurzfutter fehlt. Man müsste das Spezielle und nicht bloss das Allgemeine eines Geschehnisses, einer Veranstaltung und dergleichen aufzeichnen. Dadurch würde die Langeweile verdrängt. Und beim Speziellen, Ausgefallenen darf der Zeitungsschreiber sein dahingehendes Wissen einbeziehen, dass Geld, Essen und Trinken sowie ähnlich gelagerte Lebensäusserungen jedermann interessieren.
„Das Beste“ (Reader’s Digest) personifizierte beharrlich jeden Bericht. Der Anfang des Artikels „Wenn Ehemänner den Spass am Sex verlieren“ in der Ausgabe vom Juni 1978 lautete: „,Ich, liebe Evelyn, aber bin an Sex nicht mehr so sehr interessiert wie früher’, sagt Fred Keller (Fussnote: Die Namen sind geändert) in einem Gespräch über seine sechsjährige Ehe. ,Ich habe darüber nur nicht weiter nachgedacht.’“
Der Autor hätte auch so anfangen können: „Im Allgemeinen verliert sich das Interesse am Sex mit zunehmendem Alter.“ Es gibt hinreichend Möglichkeiten, das Vertrocknete saftiger zu präsentieren, was hier ausschliesslich an den Journalismus bezogen werden soll.
Werden solch stilmässige Kunstriffe serienweise angewandt, besteht die Gefahr, dass die persönliche Haltung des Autors zur dominanten Grösse wird, also allzusehr durchbricht. Das muss immer bedacht werden, und die eigene Meinung muss immer als solche gekennzeichnet sein; schon gar nicht darf sie einer anderen Person unterschoben werden.
Der Inhalt
Nur wer etwas zu sagen hat, kann gut schreiben. Bevor ein Journalist ein Thema angeht, müsste er sich dringend die Zeit nehmen (wenn er sie denn fände ...), alle erreichbare Literatur und alle Fachbücher und -artikel darüber zu lesen Dabei könnte er auch die richtigen, treffenden Wörter sammeln, aus denen er beim Schreiben auswählen kann. Ohne Fachbegriffe, die erklärt sein müssen, geht es oft nicht. Das Fachwissen, das bis zu den Einzelheiten reicht, strahlt Kompetenz aus, macht einen Artikel wertvoll und glaubhaft. Und auch eine kritische Feststellung des Verfassers wird ernst genommen. Kritik kann nur auf dieser Grundlage fussen.
In einem Bericht aus dem Bundeshaus hatte eine für Militärfragen zuständige Journalistin von einem „völlig neuen Panzer“ geschrieben, „der eine stärkere Panzerung gegen die neuen fremden Geschosse braucht“. Wer solche verallgemeinernde Feststellungen in die Welt setzt, die nirgends im Artikel genauer erläutert werden, hat kaum eine Fachkompetenz, und die Botschaft wird bedeutungslos.
Die Kürze und die Länge
Vielleicht sind die vermissten Detailinformationen zum neuen Panzer dem Drang oder Zwang zur Kürze zum Opfer gefallen. Das lehrt, dass nicht immer der kürzeste Artikel auch der beste ist, selbstverständlich auch nicht unbedingt der längste. Unbestritten ist dies: Aller Ballast, jedes Wort, das nicht der Information, dem Verständnis oder dem Schmuck dient, ist fehl am Platz. Der Leser ärgert sich, wenn man seine Zeit und Aufmerksamkeit mit Leerläufen in Anspruch nimmt. Das sprachliche Verwässern gleicht der Weinpanscherei. Der Unterschied besteht nur darin, dass den Informationsverdünnern meist die böse Absicht fehlt, es sei denn, es gehe um Zeilenschinderei (früher wurde oft pro Zeile honoriert). Das Missverhältnis zwischen Form und Gehalt macht sich als Schwulst bemerkbar.
Vieles spricht für längere Artikel, jedenfalls für angemessen lange. Zwar kann der Inhalt jedes Romans auf 20 Zeilen zusammengefasst werden; den Beweis dafür liefern die Klappentexte. Die volle Anteilnahme des Lesers ist aber nur durch eine detaillierte Schilderung zu gewinnen. Auf die Zeitungsschreiberei übertragen: Wer überzeugen will, erreicht diesen Zweck nur durch eine Ausführlichkeit, die selbst gelegentlich vor der betonenden Wiederholung einer Angabe oder Gedankens nicht zurückschreckt. Nur eine Fülle kann nachwirken.
In der Darstellung des Sachverhalts müssen alle Elemente versammelt sein, die für das Verstehen eines Problems nötig sind. Die Devise „Kurz und bündig“ bezieht sich im besten Fall auf das Weglassen von allem Überflüssigen. Anderseits darf nichts zum Verständnis oder zur Beurteilung Nötiges fehlen.
Die Bündigkeit ihrerseits, der innere Zusammenhang der Gedankenglieder, muss immer vorhanden sein – von kurzen bis zu langen Artikeln. Ein gutes Beispiel von Bündigkeit lieferte AT-Redaktor Hermann Rauber: „Seit einiger Zeit rollt der Regionalbus rund um und durch Aarau. Nach den ersten Erfahrungen war man alsbald bestrebt, das Netz ständig zu verbessern. So kam man auf die Idee, am Ende der Linie in den Scheibenschachen als Wendeplatz eine Busschleife zu ziehen. Man nahm dabei in Kauf, dass diesem Ausbau 3 Bündtenplätze zum Opfer fielen. Das rief aber den passionierten Gärtner Jakob („Joggi“) Dössegger auf den Plan, der sich über derartige Pläne beschwerte, beim Stadtrat indessen abblitzte. Doch Joggi D. gab sich nicht so schnell geschlagen und zog die Sache vor die kantonal-aargauischen Instanzen weiter. Am letzten Montagmorgen um 8.30 Uhr fand im Scheibenschachen der historische Augenschein statt. Der Entscheid der Regierung steht noch aus.“
Hier wurde zusammenhängend geschrieben; das fliesst. Alle Fakten sind eingebaut – ein Lesevergnügen. Und über die Urteilsverkündung wird man wieder gern lesen.
Das Leadsystem
Das Leadsystem wurde bereits angesprochen. Es verdient eine eingehendere Betrachtung, weil es den Journalismus prägt. Bei dieser allgemein verbreiteten Art, einen Artikel aufzubauen, wird alles, was dem Verfasser wesentlich zu sein scheint, an den Anfang der Arbeit gestellt und häufig über 2 Spalten hinweg im Fettdruck präsentiert. Anschliessend werden die Fakten mit abnehmender Wichtigkeit aufgelistet, so dass die Arbeit nach immer dünner, wässriger wird. Für die Zeitungsmacher hat dies den Vorteil, dass sie einen Text von hinten problemlos kürzen können (je nach Platzverhältnissen), ohne Gefahr zu laufen, dass Wesentliches geopfert wird.
Doch dient das auch dem Lesen, dem Leser? Man muss hier die seelischen Kraftgesetze des Lesers, das heisst: dessen Ermüdungserscheinungen, in die Überlegungen einbeziehen. Beim Lesen lässt die Aufmerksamkeit nach, falls nicht ständig aufgerüttelt wird, und dieser nachlassenden Aufmerksamkeit begegnet man ausgerechnet mit einem inhaltlich nachlassenden Stoff. Das ist genau verkehrt – das grosse Gähnen macht sich breit.
Mit dem Titel weckt der Autor das Interesse des Lesers; doch darf die Überschrift nicht mehr versprechen als die nachfolgende Botschaft bietet. Der Lead (Vorspann) sagt Wesentliches aus und kann, wenn er gut formuliert ist, durchaus zum Weiterlesen anspornen. In manchen Dramen Shakespeares wird schon im Prolog das traurige Schicksal des Helden verkündet, ohne dass dadurch die Spannung verloren geht. Der Leser muss jedoch mit fairen Mitteln festgehalten werden. Nur dem ausharrenden Leser können für ihn wichtige Botschaften vollumfänglich mitgeteilt werden. Eine Arbeit muss gegen hinten im Ton anschwellen; Sätze sollten dort tendenziell kürzer und einfacher werden. Man geht vom Bekannten zum weniger Bekannten und bis zum Unbekannten. Der Leser darf nie eine Leere verspüren.
Lustig
Zum Festhalten darf man einen Kunstgriff benützen: den Humor. Wenn des Lesers Interesse zu erlahmen droht, muss man ihn wieder in Stimmung bringen. Der Humor ist ein hervorragendes journalistisches Mittel und keineswegs weniger vornehm als die Langeweile. Witz ist Würze, nicht Speise, das heisst, man sollte damit sparsam umgehen. Wohltuend sind oft auch Wortspielereien: „Helmut Schön, der Mann mit der Mütze, nimmt den Hut.“
Ein Gedanke nach dem anderen
Eine klare Sprache gehört dazu, wenn man den Leser hindern will, davonzulaufen. Sie sollte nicht wie die Meeresbrandung daherrollen, worin die zweite Welle die erste überholt, die dritte die zweite und alle im Zusammenprall als Gischt verstieben. Dazu ein abschreckendes Beispiel: „Es gilt als so gut wie sicher, dass der türkische Politiker Bülent Ecevit das von Alexej N. Kossigyn, ehemaliger russischer Ministerpräsident, seinerzeit vorgeschlagene politische Dokument – eine Art Freundschafts- und Nichtangriffspakt –, dessen Abschluss Ankara immer wieder hinauszögerte, unterzeichnet wird.“
Man sollte in aller Regel einen neuen gedanklichen Schritt erst dann tun, wenn der vorangegangene abgeschlossen ist. Der Leser soll nicht ein wirres Gedankengeflecht entflechten und sich dabei über den lausigen Stil des Schreibers ärgern müssen. Eine Maschine, bei der die meiste Energie durch Reibungsverluste verloren geht, ist unbrauchbar.
Kraft der Metaphern
Der vorangegangene Satz kann auch als Beispiel für eine bildhafte Sprache dienen. Metaphern machen einen Text farbig. Die Bilder dürfen nur nicht schief hängen. Gerade noch knapp an einer Verkrümmung vorbeigeschrammt ist dieser Satz, den Hans Ulrich Kersten aus Berlin schrieb: „Es besteht für den Westen kein Anlass, die damaligen Ereignisse im Fluss der Geschichte versickern zu lassen.“
Der ehemalige Schweizer Bundesrat Willi Ritschard beherrschte die bildkräftige Sprache recht gut: „Wir sind eine Ölgesellschaft auf Abruf.“ Oder: „Für immer mehr Menschen besteht Freizeit aus dem Drehen des Fernsehknopfs und Freiheit aus der Möglichkeit, zwischen mehreren Programmen zu wählen.“
Abgedroschen sind anderseits Wendungen wie „am Ball bleiben“, „der Fünfer und das Weggli“ oder „Wind aus den Segeln nehmen“. Es fehlt da nur noch „das grüne Licht“. Das sind abgeschlaffte Formulierungen, die einen Bericht nicht besser machen. Eines der schönen, treffendsten Bilder stammt von Arthur Schopenhauer, der die Presse mit „dem Sekundenzeiger der Geschichte“ verglichen hat.
Anfang und Schluss
Zum Schluss noch etwas über den Anfang und den Schluss einer journalistischen Arbeit. Wenn der Schreiber einen blendenden Einfall an den Anfang eines Artikels stellt, weckt er damit grösste Erwartungen. War dieser blendend Anfang aber sein einziger, letzter Einfall, enttäuscht er die Leserschaft. Es ist, bildhaft ausgedrückt, wie eine Prunktreppe, die in eine Gerümpelkammer hinauf führt.
Gelungen war der Anfang eines Porträts über den Schauspieler Paul Hubschmid, das Ulrich („Ueli“) Weber fürs AT verfasste: „Am Dienstagabend traf Hubschmid, von Berlin kommend, in Schönenwerd SO ein, am Sonntag reiste er nach St. Tropez ab. Dazwischen liegen 5 Tage in seiner alten Heimat.“
Das war ein anregender Beginn, bestehend aus bescheidenen Mitteln, der passende, geradezu einladend Auftakt zu einem Porträt. Je stärker die Thematik ist, desto zurückhaltender darf die Einleitung sein.
Misslungen war die Berichterstattung über einen Betrugsversuch, der vom Bezirksgericht Bremgarten AG behandelt wurde. Der Beginn war langweilig, flach: „Vor dem Bezirksgericht hatte sich ein früherer Geschäftsführer einer Metzgerei zu verantworten.“ Es folgten Hinweise auf einen Betrugsversuch, der Antrag des Anklägers und erst dann das Urteil. Besser wäre gewesen: „Ein angeklagter ehemaliger Geschäftsführer einer Metzgerei wollte am gestohlenen Fleisch nicht mehr als üblich verdienen. Deshalb wurde er vom Bezirksgericht Bremgarten freigesprochen.“
Die Wirkung des letzten Satzes darf nicht unterschätzt werden. Das bedeutet nicht, dass man die wichtigste Information auf den Schluss aufsparen sollte. Aber ein frischer, origineller, abrundender Gedanke sollte ein Dank an den Leser fürs Ausharren sein.
Die Endstation heisst nicht Sehnsucht (Sehnsucht nach einem gelungenen Schluss), sondern Schlusseffekt.
Hinweis auf weitere Blogs zur Sprache
29.07.2005: Oft stört mich das Wort „verkaufen“
26.02.2005: Die unsägliche Mühe mit der Ich-Form
17.01.2005: Hier wird die Bitte um Kurzfutter erfüllt
Hinweis auf weitere Blogs von Eisenkopf Werner
Der neue Kirchen-Teufel 2024 ist BLAU
Deutsche Bauernproteste als Mosaikstein gegen grüne Weltbeglücker
Kommunale Walliser Foto-Stative und Rätsel zur Mischabelgruppe
"65" ist in Deutschland offenbar das neue "42"? HABECK-Heizungs-Science-Fiction?
"KLIMA-PASS" vorgeschlagen - Betrug mit Meeresspiegel als Einwanderungshilfe?
84 Millionen im Klammergriff eines Polit-Clans?
Wird deutsche Politik jetzt zum "GeTWITTERten Comic" ?
Die EU für Schweizer - einmal anders betrachtet (Teil 2)
Die EU für Schweizer - einmal anders betrachtet (Teil 1)
SOCIAL-MEDIA und die Freude an der Nicht-Existenz
KLIMA - Extreme Hitze und Trockenheit gab es bereits oft und schlimmer
Extremhochwasser und Hunderte Tote an der deutschen Ahr - seit 1348 aufgezeichnet
Will die CH der BRD in die totale Zwangswirtschaft folgen?
Ketzerworte zur CO2-Gesetzgebung und CH-Abstimmung am 13. Juni 2021